Denk ich an Israel
Ich habe an den Anfang des Gedichtes „Nachtgedanken“ von Heinrich Heine gedacht,
als ich einen Titel für mein Buch suchte:
„DENK ICH AN DEUTSCHLAND IN DER NACHT,
DANN BIN ICH UM DEN SCHLAF GEBRACHT,…“
Dabei hat Heine wohl mehr an seine alte Mutter in Deutschland gedacht als an sein
Heimatland; denn er lebte damals in Paris im französischen Exil.
Er war von seiner geliebten Mutter durch widrige, politische und persönliche
Umstände getrennt. Und ich? Ich fühle mich von Israel „getrennt“, einem Land, das ich in zehn Reisen besucht und lieben gelernt habe.
Ich bin aber auch in einer gewissen Trauer mit Israel verbunden, wenn ich z.B. die Berichte der israelischen Nichtregierungsorganisation B’Tselem lese. In diesen Berichten werden Übergriffe israelischer Siedler und der israelischen Armee gegenüber der palästinensischen Bevölkerung dokumentiert.
Als Christ bin ich aber auch mit der jüdischen Religion verbunden, denn Jesus war Jude und die jüdische Religion ist die „Mutter“ der christlichen Religion.
Die christliche Kirche, „die Tochter“, hat nach dem Holocaust ein neues Verhältnis zu
ihrer „Mutter“ gesucht. Seit 1986 war ich als Synodalbeauftragter im Kirchenkreis Dinslaken an dem Prozess der Erneuerung des Verhältnisses der Kirche zum Judentum beteiligt.
Prof. Dr. Heinz Kremers war einer der Pioniere des christlich-jüdischen Dialogs nach
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Durch ihn bin ich auf die Spur der Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden gekommen. Er war es auch, der eine Beteiligung von deutschen Siedlern in Nes Ammim bewirkt hat.
Von 1985 bis 2018 war ich zehnmal in Israel, zuletzt im Mai 2018.
Ich will natürlich nicht alle Stationen meiner Reisen nach Israel bedenken.
Meine Israel-Beobachtungen habe ich, unterstützt von meinen Fotografien und Texten anderer Autoren, zu den folgenden Themen zusammengefasst.
Jürgen Leipner - „Denk ich an Israel …“ Annäherungen an ein besonderes Land, Eigenverlag 20 €
Foto: Bilder: J. Leipner: Buchgestaltung: Sofia Tschrepp


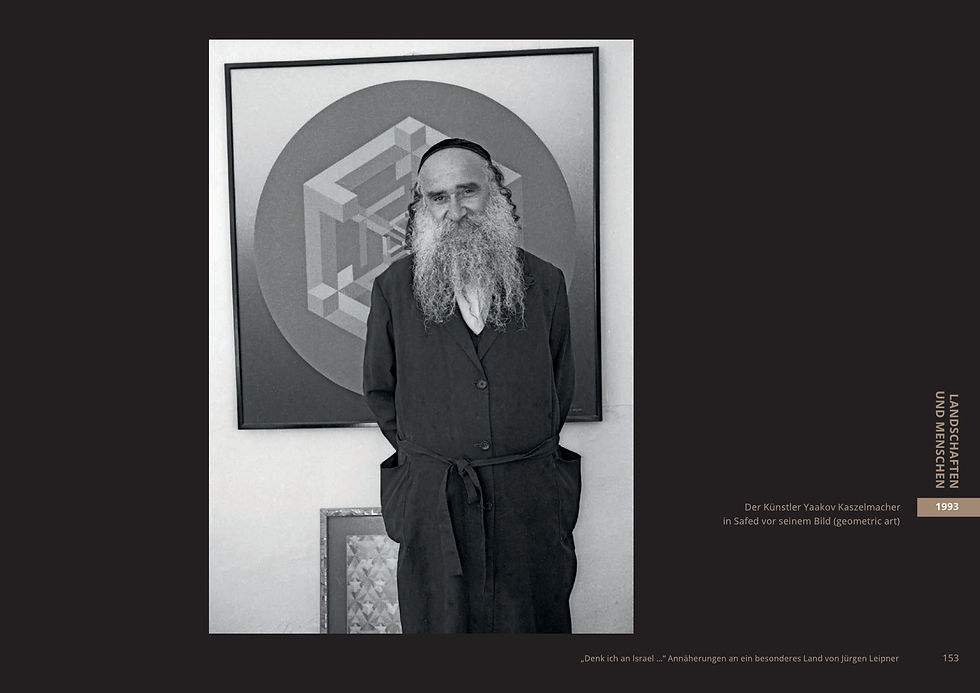

Epilog
Perspektiven auf das Land Israel
Als ich 1985 zum ersten Mal Israel besuchte, es war in der Osterzeit, stand die
Begegnung mit der jüdischen Religion im Vordergrund. Das Pessach Fest
konnte ich in einer israelischen Familie in Jerusalem als Gast mitfeiern. Beim
Besuch des jüdischen Viertels in der Altstadt Jerusalems beobachtete ich das
entspannte Leben der Israelis. In meinem Bewusstsein war dabei auch die
bedrohte Existenz Israels präsent, denn der Sechs-Tage-Krieg von 1967 und der
Yom-Kippur-Krieg von 1973 waren noch in lebendiger Erinnerung. Die späteren
Reisen nach Israel standen unter dem Motto: Menschen arbeiten – wohnen –
glauben. Unser Ziel war es dabei, einen lebendigen Eindruck von der
Lebenswirklichkeit dieses neuen Staates zu erhalten.
Im Jahr 2000 war ich mit meiner Reisegruppe in Israel, als die zweite Intifada
ausbrach. Ariel Sharon hatte durch seinen Besuch auf dem Tempelberg
demonstrieren wollen, dass Juden den Ort betreten dürfen, wo früher der
jüdische Tempel gestanden hatte. Er hatte damit die Araber in Israel provoziert.
Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Unsere Reisegruppe war
Zeuge für den akuten Ausbruch des israelisch-palästinensischen Konflikts.
In dem Seminar im Jahre 2009 unter dem Thema „Menschenrechte in den
Traditionen Israels“ ergab sich ein besonderer Blick auf die Lebenswirklichkeit
Israels. Wir standen vor der „separation barrier“, die Israel von der Westbank
trennen soll. Diese Trennungsmauer ist mir ein Symbol für das Verhältnis der
beiden Volksgruppen, Israelis und Palästinenser, geworden.
Rückblickend kann ich also feststellen, dass meine Perspektive immer mehr auf
die komplexe Lebenswirklichkeit des Landes Israel ausgerichtet wurde, in dem
Juden und Palästinenser leben.
Meine Sorgen um die bedrohte Existenz des Staates Israel verbanden sich mit
den Sorgen um die gefährdeten Lebensmöglichkeiten der Palästinenser. Mein
Blick fällt also nicht nur auf die eine Seite der “Mauer“, ich nehme auch die
Lebenswirklichkeit auf der anderen Seite in Betracht. Nach meinen
Beobachtungen nehmen die meisten Israelis und Juden in Deutschland nur das
Leben diesseits der Mauer wahr, wo die „Heimstätte für das jüdische Volk“
eingerichtet wurde.
Kritik an der Politik der israelischen Regierung
In meinem Buch habe ich bewusst Beiträge aufgenommen, die die andere Seite
von der Mauer beleuchten. (z. B. „Wir weigern uns Feinde zu sein“ oder „Mein
Nachbar, der Eindringling“). In diesen Darstellungen kommt Kritik an der
israelischen Regierungspolitik zum Ausdruck. Ich schließe mich dieser Kritik an
und nenne noch zwei Beschwerden über die israelische Regierungspolitik: Im
Jahr 2018 hat die israelische Nichtregierungsorganisation B`Tselem eine
Landkarte veröffentlicht, auf der die brutalen Zerstörungen von Weinbergen,
Obstanlagen und Getreideernten der Palästinenser dokumentiert werden, die
Siedler in 2018 begangen haben. Die Palästinenser wagen es nicht mehr, zu
ihren Feldern zu gehen, weil sie Angriffe von Siedlern fürchten müssen. Hinzu
kommt, dass solche Übergriffe weder von der israelischen Polizei noch vom
Militär verhindert worden sind. Auch die Nachricht der Veröffentlichung des
neuen Nationalstaatsgesetzes hat mich aufgeschreckt: Die Knesset, das
israelische Parlament, hat am 18. Juli 2018 mit knapper Mehrheit und trotz
heftiger Kritik auch aus dem eigenen Land ein Gesetz angenommen, das die
Rechte der Araber in Israel, die etwa ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen,
zusätzlich einschränken kann und den Siedlungsbau im besetzten
Westjordanland sogar verstärkt fördern soll.
Das Gesetz definiert das Land als „den Nationalstaat für jüdische Menschen“,
erklärt Hebräisch zur Nationalsprache Israels und stellt fest, dass „jüdische
Siedlungen in Israel im nationalen Interesse sind.“ Das „vereinte Jerusalem“
wird als Hauptstadt Israels bestimmt.
Es wird erwartet, dass sich das Gesetz vor allem auf die Bereiche Wohnung und
Landplanung auswirken wird.
Nun ist Kritik, die in Deutschland an der Politik des Staates Israel geäußert wird,
dem Verdacht ausgesetzt, sie sei antisemitisch. Zwei Beispiele möchte ich
anführen, wo der Antisemitismusvorwurf zu Sanktionen gegen die Kritiker
geführt hat:
1. Im Mai 2018 hat sich die Leitung der jüdischen Gemeinden in NRW gegen
eine Kritik an der Politik des Staates Israel gewendet, die in einem
Gottesdienstentwurf zum 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel
geäußert worden ist. 1 Da sich die Leitung der Evangelischen Kirche im
Rheinland (EKiR) nicht von diesem Text distanzieren wollte, wurde die
gemeinsame Reise von Vertretern der jüdischen und christlichen
Leitungsorgane nach Israel (Nes Ammim) von der jüdischen Seite
abgesagt.
2. Im Februar 2019 ging es um die Verleihung des Göttinger Friedenspreises
für eine Gruppe kritischer Juden, die „Jüdische Stimme für gerechten
Frieden in Nahost“. 2 Die Preisverleihung wird kritisiert, weil diese Gruppe
auch die Boykott Kampagne BDS unterstützt. Zur Erläuterung: BDS ist die
Abkürzung für Boykott, Desinvestigation und Sanktionen. Die Kampagne
will Druck auf die israelische Regierung ausüben, um sie zu einer
gerechteren Politik gegenüber den Palästinensern zu bewegen.
1 Vgl.Gottesdienst-Arbeitshilfe 70 Jahre Staat Israel. Download: www.ekir.de/url/bBf2 Inge Günther, Kolumne „Nahostkonflikt, made in Germany“, in: FR vom 22.2.20193
Das Komitee für die Preisverleihung widerspricht dem
Antisemitismusvorwurf: Der BDS sei eine gewaltfreie Form des Protestes
gegen den Staat Israel, nicht weil der Staat jüdisch sei, sondern wegen
Verletzungen des Völkerrechts und Verstößen gegen die
Menschenrechte von Palästinensern. Inzwischen haben die Universität
Göttingen, die Stadt Göttingen und die Sparkasse dort ihre
Unterstützung der Veranstaltung für die diesjährige Preisverleihung
abgesagt.
Die BDS Kampagne halte ich nicht für antisemitisch. Ich unterstütze sie aber
nicht, weil ein solcher Boykott, in Deutschland ausgerufen, unter Juden
Erinnerungen an den nationalsozialistischen Boykott wachruft.
Ein Boykott ist als eine öffentliche Meinungsäußerung vom Grundgesetz
gedeckt. Wie kommt es aber, dass in Deutschland, also außerhalb Israels, eine
kritische Meinungsäußerung über Israel hintertrieben wird? Nach der
Beurteilung von Tony Judt liegt das daran, dass die politische Führung Israels
den Anspruch erhebt, für Juden überall in der Welt zu sprechen. Sie sieht darin
den Hauptgrund, warum antisemitische Stimmungen in Judenfeindschaft
umschlagen. 4 In diesem Anspruch erkenne ich eine völlige Nichtachtung der
demokratischen Meinungsbildung. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Taktik,
die Kritik an der Regierungspolitik Israels zu bekämpfen. Auch in Deutschland
ist diese Taktik wirkungsvoll. Seit jeher hat der Zentralrat der Juden in
Deutschland das Auftreten von antisemitischen Vorfällen verurteilt. Dazu
gehören gewalttätige Akte gegen Synagogen, jüdische Geschäfte sowie gegen
jene, die im öffentlichen Leben als Juden identifiziert werden können. Und
auch die folgenden Handlungen und Haltungen gegenüber Juden gelten als
„antisemitisch“ und müssen, besonders in den sozialen Netzwerken beachtet
werden: Die Verbreitung von Stereotypen (z.B. „Die Juden bestimmen die
Finanzmärkte bzw. die Medien“), Verschwörungstheorien über das
Weltjudentum („Die Protokolle der Weisen von Zion“), die Ritualmordlegende,
die Zuordnung von „rassischen“ Merkmalen über Juden im Allgemeinen. All
dies sind wesentliche Merkmale für Antisemitismus und müssen bekämpft
werden. Die Kritik an der Politik der israelischen Regierung ist dagegen von
einer anderen Qualität:
Diese als antisemitisch bezeichnete Kritik an der Politik des Staates Israel ist
eher eine Form des Antizionismus, insofern als sich die Kritik gegen bestimmte
Auswirkungen des Zionismus richtet. Zionismus verstehe ich dabei als die
3 https://www.juedische–stimme.de
4 Tony Judt: Zur Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Antizionismus. S. 70. In (Hg):Christin Heilbronn,
Doron Rabinovici, Natan Sznaider: Neuer Antisemitismus? Frankfurt/Main. 2. erweiterte Auflage 2019.
Gesamtheit der Bestrebungen, das Überleben des jüdischen Volkes in einer
„Heimstätte“ im Ursprungsland Palästina zu erreichen.
Diejenigen, die eine Israelkritik grundsätzlich unter den Verdacht des
Antisemitismus stellen, möchten Bedrohungen vom Staat Israel abwehren. Die
Frage ist jedoch, ob die Bedrohungen immer von außen kommen. Die
Palästinenser werden so dargestellt, als seien sie die Bedrohung für das Leben
des Staates Israel. Meiner Ansicht nach kommt die Bedrohung für den Staat
Israel von innen: die brutale Besatzung der Westbank und des Gaza Streifens
hat zur Gegenwehr der Palästinenser geführt. „Diese Bedrohung für das Leben
kann als etwas dargestellt werden, das von jenseits der Grenze oder über die
Mauer kommt.“
5 Rückblick und Ausblick
Am 14. Mai 1948 rief Ben Gurion den Staat Israel aus, in seiner Rede
verkündete er die Unabhängigkeitserklärung des neuen Staates. Für die Israelis
war das ein Freudentag. Für die Palästinenser war es die „Nakba“, die
Katastrophe. Die zionistische Bewegung hatte ihr Ziel erreicht, eine Heimstätte
für das jüdische Volk in Palästina zu errichten. Die Palästinenser verloren in
dem Unabhängigkeitskrieg ihre Heimat, etwa 750 000 Menschen flohen oder
wurden vertrieben.
Schon am Abend des 29. November 1947 erlebten die Juden die „Geburt“ des
Staates Israel, als in New York die Abstimmung erfolgte bei der
Vollversammlung der Vereinten Nationen über die Vorlage, das britische
Mandat zu beenden und Palästina in einen unabhängigen arabischen und einen
unabhängigen jüdischen Staat aufzuteilen. Die Vorlage wurde mit Zwei-Drittel-
Mehrheit angenommen, genauer mit 33 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und 10
Enthaltungen. Amos Oz schildert in seinem Buch „Eine Geschichte von Liebe
und Finsternis“ die gewaltige Wirkung der Entscheidung unter den jüdischen
Hörern der Radioübertragung. In der Menge entstand „ein Schrei, der Steine
erschütterte und das Blut in den Adern gefrieren ließ, als hätte sich für alle
bereits Getöteten und alle, die noch getötet werden würden, in diesem einen
Augenblick ein Fenster zum Aufschreien geöffnet, das gleich wieder zuschlug,
und schon im nächsten Moment lösten diesen Schrei des Grauens laute
Freudenrufe ab, ein wildes Gewirr von heiseren Schreien und „Das Volk Israel“
lebt, und jemand versuchte die Nationalhymne zu anzustimmen.“
Als Deutscher bedrückt es mich zu sehen, dass die Juden in ihrem Staat gar
nicht so sicher leben können, wie die Gründer des Staates es sich erträumt
hatten; ein friedlicher Ausgleich zwischen der arabischen und der jüdischen
Bevölkerung ist bis heute nicht erreicht worden.
5 Judith Butler: Antisemitismus und Rassismus. Für eine Allianz der sozialen
Gerechtigkeit. S. 89. In: NeuerAntisemitismus ? Frankfurt/Main 2. Erweiterte
Auflage 2019.
Es hat in der jüngsten Geschichte des Staates Israel ein Zeitfenster von etwa
1991 bis 1995 gegeben,in dem die zionistischen Kräfte die Oberhand gewonnen hatten, die eine
Friedensregelung mit den Palästinensern ausgehandelt hatten. (siehe Anhang 1
und 2). Durch den Mord an Ministerpräsident Rabin ist diese Entwicklung
abgebrochen worden. Seitdem wird die Politik des Staates Israel sehr stark von
den ultraorthodoxen Kräften der Siedlerbewegung bestimmt.
Ministerpräsident Netanjahu hat seine Regierungen seit zehn Jahren immer mit
der Unterstützung dieser „rechten“ Kräfte bilden können. In seinen letzten
Erklärungen hat er offen bekannt, dass er eine Zweistaatenlösung für das
israelisch-palästinensische Problem ablehnt. Obwohl es unrealistisch erscheint
zu erwarten, dass dieses Ziel noch erreichbar ist, sollte doch diese Lösung nicht
ad acta gelegt werden. Was sind denn die Alternativen? Wolf Iro, der
ehemalige Leiter des Goethe-Instituts in Jerusalem, schreibt:“Es gibt nur vier
vorstellbare Zukunftsszenarien für das Land – entweder eine
Zweistaatenlösung oder aber eine sich schleichend ergebende
Einstaatenlösung, bei der sich wiederum drei Varianten böten: eine Art von
Konföderation (angesichts des jahrzehntelangen Konflikts eher eine
Wunschvorstellung). Eine radikale Demokratie (und damit aufgrund der
demographischen Gegebenheiten das sofortige Ende Israels als
selbstdefinierter jüdischer demokratischer Staat) oder eine Form von Apartheid
(um die zahlenmäßig überlegene palästinensische Bevölkerung dauerhaft zu
kontrollieren). Die beiden letztgenannten Optionen kann kein vernünftiger
Mensch in Deutschland ernsthaft wollen. Und auch in Israel favorisiert immer
noch eine Mehrheit der Bevölkerung die Schaffung zweier Staaten.“ 6
Was bleibt zu tun, um den Status Quo zu überwinden?
Nach meiner Beobachtung ist es besonders wichtig, dass die Lebenswirklichkeit
im Staat Israel nicht ausgeblendet wird. Die Gegenwart der palästinensischen
Bevölkerung wird aber von der Mehrheit der jüdischen Bevölkerung
weitgehend verdrängt. Um diese Verdrängung zu überwinden, ist die
Begegnung zwischen den beiden Volksgruppen wichtig. Es gibt in Israel viele
Organisationen, die sich um eine Begegnung von jüdischen Israelis und
Palästinensern bemühen. (In meinem Buch habe ich diese Organisationen und
Institutionen besonders beachtet). Eine Unterstützung solcher Begegnungen
halte ich für wichtig, weil dadurch ein Prozess in der israelischen Gesellschaft
gefördert wird, der zu einem Ausgleich zwischen den Bevölkerungsgruppen
führen kann.
Denk ich an Israel, …
dann fällt mir am Ende meiner Betrachtungen ein Bild ein, das ich 1994 im
Fernsehen gesehen habe. Es zeigte Kinder, die vorbeifahrenden Soldaten mit
Fähnchen zu winkten. Und die Soldaten winkten zurück. Das war in Ramallah,
der palästinensischen Stadt in der Nähe von Jerusalem, als die israelische
Armee aus der Zone A, wie im Vertrag von Oslo vereinbart, abzog.
Dieses Bild erinnert mich daran, was in der Wirklichkeit von Israel möglich war.
Und ich bin davon überzeugt, dass die Israelis einmal froh und erleichtert sind,
wenn sie nicht mehr ein anderes Volk beherrschen müssen, sondern mit ihm
eine gemeinsame Gegenwart gestalten können.
6 Wolf Iro: Nach Israel kommen. Berlin 2018. S. 69/70.
Inhalt
1. Jerusalem:
„ Jerusalem aus Gold
und aus Kupfer und aus Licht,
lass mich doch, für all deine Lieder, die Geige sein.“
Das ist der Kehrreim eines bekannten Liedes.
Meine Kamera zeigt sicherlich dieses „Jerusalem of Gold“,
sie hat sich aber auch dem Beton und zerstörten Häusern zugewandt.
das jüdische Viertel der Altstadt - das moslemische Viertel - das christliche
Viertel - die Neustadt - Ost-Jerusalem (Silvan) - die Trennungsmauer.
2. Portraits von fünf Orten
Mit der Auswahl dieser fünf Orte verbinde ich meine politische Überzeugung:
Für die Sicherheit des Staates Israel ist der Dialog zwischen den beiden
Volksgruppen, Arabern und Israelis, unverzichtbar.
Die Portraits von fünf Orten zeigen, wie die Geschichte des Landes Menschen
bewegt hat, dort zu leben und die geschilderten Projekte zum Wohl des Landes
aufzubauen.
Bethlehem
Das „Internationale Begegnungszentrum Bethlehem“ ist für die
palästinensische Bevölkerung ein Ort der Bildung, der Gesundheit und der
Hoffnung. Die Schule „Talitha Kumi“ will als christliche Bildungseinrichtung die
Identität der Schülerinnen und Schüler stärken und sie so in ihrem Kontext
friedensfähig machen.
Nes Ammim
Die christliche Siedlung Nes Ammim ist ein Projekt, das in den 60 er Jahren
gegründet wurde, als Christen aus Holland, der Schweiz und Deutschland ein
Zeichen der Solidarität mit dem Staat Israel setzen wollten. Dabei wird die
Solidarität mit dem Staat Israel gelebt, ohne die Solidarität mit den arabischen
Israelis und den Palästinensern zu verleugnen. Die Studienleitung von Nes
Ammim spricht darum von einer „doppelten Solidarität“ mit Israel. Sie erkennt
damit die gesellschaftliche Realität im Staat Israel an, die darin besteht, dass
zwei Völker das gleiche Land beanspruchen. Nes Ammim möchte mit seinem
„Centre of Dialogue for Peace“ einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben
der beiden Volksgruppen leisten.
Shavei Zion und Lochame Hagetaot
Die Gründung dieser Siedlungen steht in kausaler Beziehung zum Holocaust.
Dabei war der Zionismus weit vor der Nazi-Herrschaft entstanden mit dem Ziel,
die jahrhundertelange Verfolgung in christlichen Ländern zu beenden und den
Juden eine nationale Heimstatt zu schaffen.
Neve Shalom/Wahat al Salam (NSWAS)
Neve Shalom/Wahat al Salam ist eine Siedlung, die in herausragender Weise
den Dialog von arabischen und jüdischen Israelis und Palästinensern fördert.
Die Begegnung kann die Ängste vor den Anderen abbauen helfen. Das
Aussprechen der eigenen Ansichten, die oft konträr zu denen des Gegenüber
stehen, schafft eine Atmosphäre , die als befreiend erlebt wird, weil sie nicht
sanktioniert wird. Im „normalen“ Leben der arabischen Israelis und
Palästinenser kommen die Israelis meist nur als Soldaten und Polizisten vor;
während jüdische Israelis „normalerweise“ die arabische Volksgruppe meist nur
als mögliche Terroristen zur Kenntnis nehmen, wenn überhaupt.
3. Landschaften und Menschen:
Am See Genezareth - Wanderung durch das Wadi Quelt - Wanderung am Dan -
Tel Aviv - Akko - Menschen
4. Anhang mit Hintergrundtexten
1. Wem gehört das Land? Oder: Die israelische Siedlungspolitik
2. Die Regierung von Jitzhak Rabin im Friedensprozess
3. Reportage von Anne Fromm über das Zusammenleben von arabischen
und jüdischen Israelis in Ost-Jerusalem:“Mein Nachbar, der Eindringling“
in: taz vom 11.02.2015
4. Bericht des EAPPI, des ökumenischen Begleitprogramms für einen
gerechten Frieden in Palästina und Israel, über einen Konflikt auf der
Westbank bei Bethlehem: Tent of Nations – „Wir weigern uns, Feinde zu
sein“ von Dr. Reinhard J. Voß
5. Bericht von einem Westbank Seminar der Volontäre von Nes Ammim im
Mai 2018
6. Rainer Stuhlmann: Zwei Texte aus seinem Buch „Zwischen den Stühlen“:
Die Täter zur Rede stellen. Und: Falsche Freunde
7. Die Inhaftierung von palästinensischen Jugendlichen in Ost-Jerusalem.
Bericht von B`Tselem und Ha Moked 2017
8. Inge Günther: Exodus aus Bethlehem. In: Frankfurter Rundschau vom
21.12.2017
9. Hanno Loewy: Demokratie in Israel. Frankfurter Rundschau 20.11.2017.
10. Die UN Beschlüsse 242 und 338
11. Die Dauerausstellungen im Kibbuz Lochame Ha Getaot. Eine Übersicht
12. Erinnerungen von Heinz Fröhlich, einem der Pioniere von Shave Tzion,
an die Nazi-Zeit
13. Gedanken zum Pessach Fest
14. Der Schriftgelehrte Chaim über das Pessach Fest
15. Theologische Betrachtung zum Verhältnis von Christen und Juden
16. Predigtder Rabbinerin Sarra Lev, Rabbis for Human Rights, in Beit Jala im
Rahmen der Friedenswoche Juli 2009
17. Das Beduinen-Dorf Khan-al-Achmar auf der Westbank
5. Epilog
Literaturverzeichnis
Geleitwort